Unterwegs 2023
22. Dez 2023, Mainz
Video

Story
Deckblatt
» Ich schildere nicht das Sein, ich schildere das Unterwegs-Sein. «
Michel de Montaigne
Für meine Familie und meine Freund:innen. Menschen, die ich bei mir trage, ganz gleich wie weit der Weg auch sein mag.
Philipp Neuweiler
Langer Lulatsch, Baujahr 1992, hat das Pech, dass sich sein Gehirn recht aufwändige Geschenkideen ausdenkt. Dabei nimmt er’s mit der Rechtschreibung nicht so genau und hofft auf die Gnade seiner Leser:innen. Viel Freude mit ein paar Reiseanekdoten aus dem letzten Jahrzehnt.
Nutzung
© 2023 Philipp Neuweiler
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Der Autor bleibt Inhaber aller Rechte.
Lizenz:
Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Erstveröffentlichung:
https://philipp-neuweiler.de
Inhalt
- Ins Unbekannte | Deutschland 2023
- Yoga im Steinkreis | Irland 2013
- Lauf, Rucksackmann | England 2014
- 250 Meilen Gastfreundschaft | Hitchhiking 2014
- Ein Sommer mit dir | Spanien 2017
- Durch die Wüste | Israel 2022
- Nach Norden | Skandinavien 2022
- Kreuzfahrt | Skandinavien 2022
- Impfcocktail | Deutschland / Nepal 2023
- Zwei Jungs aus Bodnath | Nepal 2023
- Die beiden Globetrotterinnen | Nepal 2023
- Annapurna Base Camp | Nepal 2023
- Theater in Kathmandu | Nepal 2023
- Ankommen lernen | Deutschland 2023
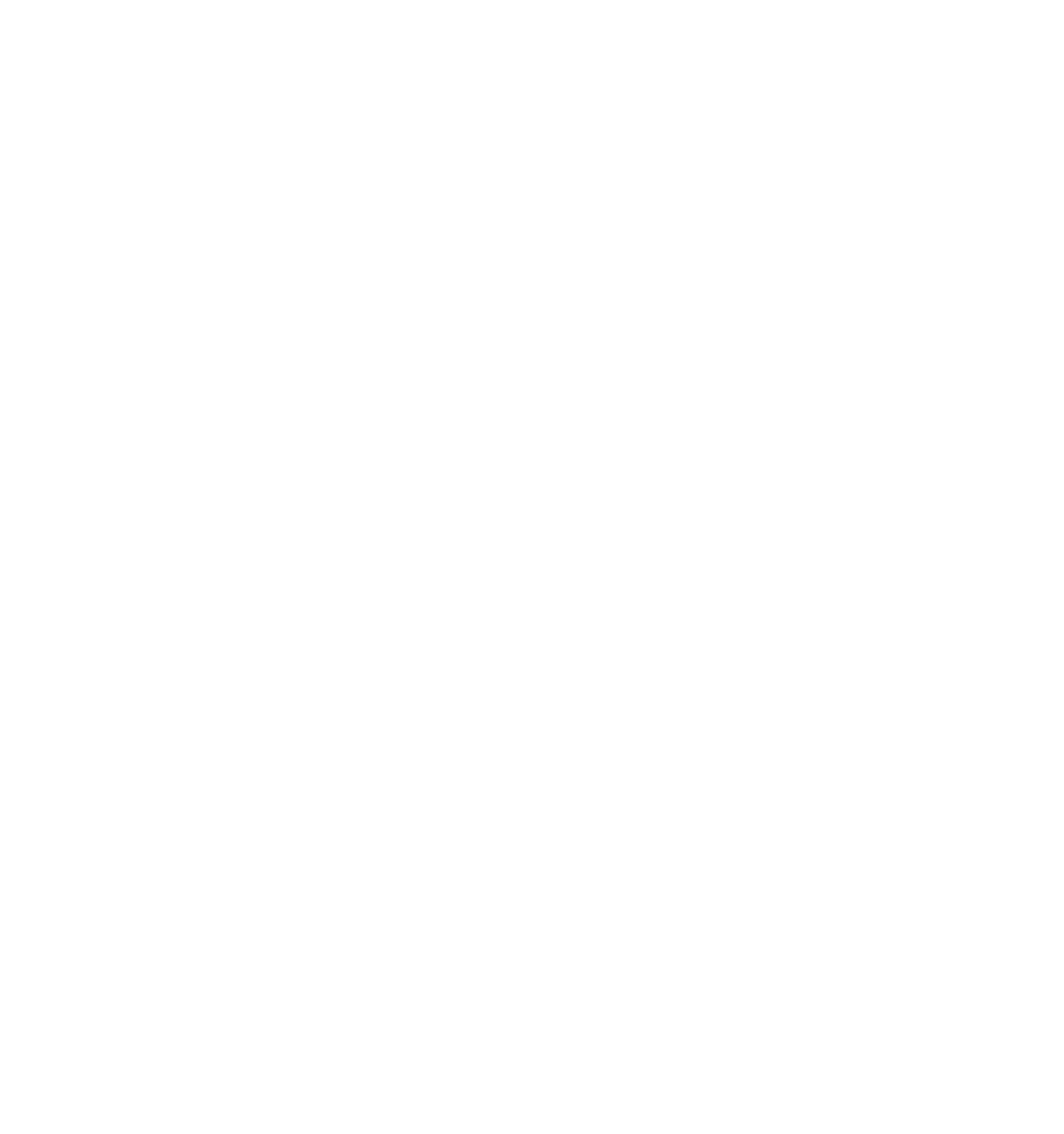
Negev Wüste, Israel | Aug 2022
Ins Unbekannte
Deutschland 2023
Wann beginnt eine Reise? Mit dem Aufbruch oder bereits mit dem Fernweh? Du wartest auf den Sprung. Auf eine größere Zustandsveränderung. Wie lästig, wenn der Kopf zwischen dem Hier und dem Dort unermüdlich springt, der Aufbruch aber noch in der Zukunft liegt. Und aus Langeweile beginnt das Zweifeln: Hast du irgendetwas vergessen einzupacken? Wirst du durchkommen nur mit Rucksackgepäck? Wirst du Tage lang durch den Regen stapfen?
Ich lausche einem Podcast, in dem es überspitzt heißt: „Reisen ist die Organisation von Schlafen, Essen und Transport unter erschwerten Bedingungen an einem anderen Ort.” Die Autorin lässt sich, mit gutem Grund, über die Romantisierung des Reisens aus. Auch ich denke häufig über meine Rolle als privilegierter, europäischer Backpacker nach. Ist das ‚Reisen zur Selbstfindung‘ einfach ein Nebenprodukt der Tourismusbranche? Ein Überbleibsel kolonialer Zeiten?
Dazu habe ich mir eine absurde Geschichte ausgedacht: Stelle dir vor, du läufst über den Asan Basar in Kathmandu und plötzlich bietet dir ein Händler ein verziertes Kästchen an. Darin enthalten: Die Erleuchtung. „20 Rupien, Sir. Ein Schnäppchen.” Angenommen die Exotik-Box wäre echt, würdest du zuschlagen? Was wäre für dich die ‚Erleuchtung’? Ich muss bei dieser bizarren Vorstellung stets schmunzeln, weil nichts daran passen will …
Auch wenn ich nicht glaube, dass sich das ‚authentische Selbst’ oder ‚Glück’ einfach finden lässt wie ein Edelstein im Kiesstrand, so lernst du doch eine Menge durch das Unterwegs-Sein. Das ist meine größte Motivation: Sich selbst mit einer völlig neuen Umgebung konfrontieren und schauen, was du über dich und die Welt erfährst. So hoffe ich jedes Mal, dass es mehr wird als reines Sightseeing. Mehr als die ‚Koordination von Schlafen, Essen und Transport’. Ganz dem Essay von Montaigne folgend eine Schule, um „dem Geist unausgesetzt die Mannigfaltigkeit so vieler Daseinsweisen, Anschauungen und Gebräuche vorzuführen und ihn an diesem ewigen Wandel der Erscheinungsformen unserer Natur Geschmack finden zu lassen.“
Die Abschiede vor einer Reise bieten schöne Anlässe, viele Menschen nochmals zu sehen. Denn für eine Mondphase werde ich Alltag, Familie und Freunde fasten. Zumindest ihre Nähe und Präsenz. Dabei wird mir jedes Mal wieder bewusst, wie wichtig mir alle sind.
Ich bekomme auch viel Wertvolles mit auf den Weg. Zum Beispiel diesen Reisegruß einer Freundin. Es ist ein Gedicht des spanischen Lyrikers Antonio Machado, das sie mir übersetzt hat:
„Wanderer, Deine Spuren
sind der Weg und sonst nichts;
Wanderer, es gibt keinen Weg
Der Weg entsteht im Gehen.
Im Gehen entsteht der Weg
Und blickst Du zurück
Siehst Du den Pfad, den Du
Nie wieder betreten wirst.
Wanderer, es gibt keinen Weg
Nur Kielspuren im Meer.”
Yoga im Steinkreis
Irland 2013
Kerry Airport ist der kleinste Flughafen, den ich je gesehen habe. Das Terminal ist nicht viel größer als eine Scheune, umgeben von immergrünen Hügelketten. Da kein Bus fährt, stapfe ich im Nieselregen die Landstraße entlang, positioniere mich nach einer Meile an der einzigen Weggabelung und halte zum ersten Mal in meinem Leben den Daumen heraus. Schon stelle ich mich auf eine längere Wartezeit ein, als bereits zehn Minuten später quietschend Reifen zum Stehen kommen.
Václav ist Tscheche, wohnt bei einem irischen Fischer an der Westküste und ist derzeit arbeitslos, was ihn jedoch nicht entmutigt, verirrte Reisende bei sich aufzunehmen. Als Willkommensgeschenk überreicht er mir feierlich einen Kieselstein, den er mit äußerster Behutsamkeit in meine Hand legt. Ich gebe mich beeindruckt, weiß jedoch nicht, was ich mit dem Klumpen anfangen soll. Weder schmiegt er sich gut in die Hand, noch besitzt er eine hübsche Farbe. Václav erzählt etwas über Energieströme und Gesteine als Speichermedien für heilende Kräfte. Demonstrativ hebt er seine Bettmatratze. Es ist mir ein Rätsel, wie jemand mit so viel Geröll unterm Kopfkissen ein Auge zu tut. „Übrigens haben wir gerade kein Öl im Heizkeller. Könnte also ein bisschen frisch werden heute Nacht.“
Am Morgen wundere ich mich beinahe, dass die Holzdielen nicht mit Frost überzogen sind. Nicht mal der Strom im Bad funktioniert. Obwohl die Fenster geschlossen sind, herrscht stets ein leichter Windzug. Rings um das Waschbecken häufen sich in bester studentischer Manier die Bartstoppel mehrerer Generationen. Am Frühstückstisch berichtet Václav von keltischen Steinkreisen, die sich in dem angrenzenden Nationalpark befinden. „Wenn du möchtest, können wir mit den Rädern hinfahren?“
Wir schnappen uns also zwei altersschwache Drahtesel. Habe ich schon den Regen erwähnt? Man kann es nicht oft genug wiederholen. Am Ufer eines kleinen Sees steigt Václav plötzlich ab, reckt die Arme gen Himmel und vollführt eine Tai-Chi-artige Bewegung. „Gegen den Regen“, erklärt er. Ich stehe nur stumm daneben und beobachte, wie der Regen unsere Sättel durchtränkt. Nichts gegen fremde Kulturen, aber es erscheint mir doch recht leichtsinnig anzunehmen, dass sich über lautes, monotones Summen und Armfuchteln der Aggregatszustand der Wassermassen hunderte Meter über unseren Köpfen beeinflussen lässt. Er vollführt dieses Ritual noch an zwei weiteren Stellen und schließlich oben auf dem Hügel zwischen den Monolithen.
Der Kreis ist recht klein und besteht aus fünf Hinkelsteinen. Ich berühre die moosüberzogene Oberfläche und stelle mir vor, wie diese Felsen wohl vor tausenden Jahren von den Druiden hier heraufgeschleppt wurden.
Rings um uns verschluckt das Nebelmeer die Landschaft. Václav versorgt seine Kieselsteine. Platziert sie neben ihre mächtigen, uralten Artgenossen, damit sie die Energie der Erdströme in sich aufnehmen. Dann murmelt er etwas vom kleinen Volk. Abermals bin ich unsicher, ob er sich einen Scherz erlaubt oder tatsächlich an Feengeschichten glaubt. Erneut stellt er sich breitbeinig hin – diesmal im Zentrum des Steinkreises – und lacht mit ausgebreiteten Armen dem Regen ins Gesicht. Es reizt mich, die Szene fotografisch festzuhalten. Ansonsten wird es mir ohnehin niemand glauben. Doch als er zu mir hinüberschau, fühle ich mich ertappt und tue so, als würde ich seine Armbewegungen imitieren.
„Ziemlich beeindruckend“, heuchele ich und dann, „Kann man das lernen?“ Strahlend winkt er mich zu sich, spricht von Chakren und Energiefeldern, erläutert mir Punkte und Bewegungen. Wir beugen uns nun also gemeinsam vor und schöpfen unsichtbare Energie, die wir an unserer Brust entlangführen, um sie dann den Wolkenmassen entgegenzuschleudern.
So beginnt unser Tanz im strömenden irischen Regen. Immer wieder beugen wir uns vor, schöpften Energie. Ich erkenne einen Wasserfall, der in der Ferne glitzert. Wilde Schafe, die sich an unseren Rädern zu schaffen machen. Wieder vorbeugen und schöpfen. Inzwischen haben sich die Wolken fast aufgelöst und das Panorama zeigt sich in voller Pracht: Zu Fuß des Wasserfalls ergießt sich ein himmelblauer See. Strahlend beuge ich mich erneut vor, versuche den Moment in mich aufzunehmen – meinen verrückten Gefährten an meiner Seite. Vermutlich tue ich ihm unrecht und bin einfach zu engstirnig gewesen. Zu fixiert. Neugierde und Offenheit sind zwei Tugenden, die man auf Reisen wie dieser stets im Gepäck führen sollte.
Und wieder recken wir die Hände gen Himmel. Es ist erst mein zweiter Tag in Irland. Hat unser Regentanz tatsächlich etwas bewirkt?! Viel zu spät erst wird mir klar, dass es aufgehört hat zu regnen.
Lauf, Rucksackmann
England 2014
Die Sportart ist bekannt unter dem Namen „Auf die Bahn hetzen.“ Dabei werden Sprint und Parkour elegant kombiniert. Im Wettlauf gegen verspätete Züge stellen sich dem Bahn-Sprinter die Stolperfallen des urbanen Lebens. Als Sportbekleidung genügt ein Regenmantel. Dazu ein Rollkoffer in der einen, ein Regenschirm in der anderen Hand. Ideal, um das Passanten-Meer vor sich zu teilen. Ich vermute, mein Körper zwingt mich dazu. Nach besonders sitzfaulen Stunden vergisst er die Zeit und treibt mich dann zu ungeahnten Höchstleistungen.
Den absurdesten Lauf habe ich in Birmingham zurückgelegt: Ich bin auf der Durchreise und auf dem Weg zu einem Freund in Oxford. Das Busticket ist bereits bezahlt, nur zieht sich der Abschied von meinem Gastgeber länger als beabsichtigt. Höflich schreite ich um die nächste Häuserecke, bis ich außer Sicht bin. Dann renne ich los wie der Teufel. Laut Plan dauert es dreißig Minuten zur Haltestelle von denen ich nur zwanzig übrig habe. Und wie es der Zufall will, findet am heutigen Sonntag in der Innenstadt ein City-Lauf statt. Alles schwappt über vor Menschen. Kein Durchkommen, keine Möglichkeiten abzukürzen. Bis mich ein absurder Gedanke beschleicht: Ich laufe mit. Renne neben den verschwitzten, kurzärmlichen Halbmarathonläufern her. Ich, in meiner dicken Winterjacke. Den schweren Rucksack wie ein Schildkrötenpanzer hinten auf. Frisch ausgeschlafen überhole ich nach und nach die anderen Läufer. Das beschert mir Jubelrufe von allen Seiten: „Lauf, Rucksackmann! Lauf!“ Und wie ich laufe. Begleitet von spontanem Beifall, bis ich mich abkoppele und den Bus tatsächlich noch erwische. Pünktlich in allerletzter Minute.
Meist ist es ein undankbarer Sport. Doch bisweilen ergeben sich skurrile Zwischenfälle wie dieser – völlig unerwartet, aber auf eine absurde Art und Weise beflügelnd.
250 Meilen Gastfreundschaft
Hitchhiking 2014
Aufgewacht in einem miefenden Studierenden-Wohnheim, irgendwo in Canterbury. Die Tatsache, dass ich mich auf dem harten Fußboden wiederfinde und um acht Uhr auch noch der Feueralarm losschrillt, geben mir zu verstehen, mich schleunigst vom Acker zu machen.
Als die Fähre in Dover ablegt, wird mir bewusst: Ich hänge schon wieder völlig in der Luft. Sehe dabei zu, wie sich mein Reiseweg hinter mir in Gischt auflöst. Und der Blick voraus? Nun, mein ‚Plan‘ ist es bis nach Hause zu trampen. Bis nach Mainz. Von Calais liegt da ein gutes Stück Belgien und Holland dazwischen. Und außer meinem Freund in Maastricht habe ich keine Anlaufstellen. Kein Auto. Nur meinen Rucksack und eine Portion Leichtsinn im Gepäck.
Ich rechne mit einer halben Woche und sehe mich bereits drüben in Calais nach einem Hostel suchen – mit Händen und Füßen ringend. Denn Französisch beherrsche ich kein Wort.
Da fällt mir ein altes Pärchen auf, das vorne an der Reling steht und sich vor den White Cliffs fotografieren möchte. Aus einer Laune heraus biete ich mich an. Sie sind begeistert von meiner Aufnahme und wir kommen ins Plaudern. Die übliche Gesprächswendung: „Ach, Sie kommen auch aus Deutschland?! Ja, dann brauchen wir uns nicht weiter auf Englisch zu unterhalten.“
Ich schätze beide auf um die Siebzig. Rentner ohne Zweifel, aber trotz oder gerade durch ihr langes Leben immer noch voller Abenteuerlust. Wohin bei Ihnen die Reise gehe? – „Zurück nach Köln. Nach Hause zu unseren Kindern und Enkeln.“ Genau meine Richtung. Aber ich traue mich nicht zu fragen. Möchte nicht unhöflich wirken. Vielleicht hat der ältere Herr meine Gedanken gelesen. Wir sind schon fast über dem Ärmelkanal, als er plötzlich meint: „Wir können Sie auch gerne ein Stückchen mitnehmen.“ Wie kann jemand nur so unverschämtes Glück haben?
Ich finde mich also in einem komfortablen Familienauto wieder. Es ist bereits später Nachmittag als wir die belgische Grenze passieren. Die Zeitumstellung hat uns eine Stunde gekostet. Hätte ich die beiden nicht getroffen, würde ich vermutlich noch immer im Hafenlabyrinth von Calais festsitzen.
Die Autofahrt ist äußerst kurzweilig. Immerhin haben wir drei Lebensgeschichten auszutauschen. Ein bisschen fühle ich mich, als ob ich mit meinen Großeltern unterwegs bin. Vorbei geht’s am Stau bei Brüssel und schließlich bis kurz vor Maastricht. Wir haben ausgemacht, dass sie mich am nächstgelegensten Ort auf ihrer Strecke absetzen. Doch es gibt so viel zu lachen, bis sie schließlich meinen:
„Ach, eigentlich erwartet uns heute Abend keiner mehr daheim. Ob wir nun ein paar Stunden später ankommen, macht keinen Unterschied. Wir bringen Sie bis ins Zentrum.“ Ich protestiere, das sei zu viel der Großherzigkeit. Aber sie nehmen bereits die Ausfahrt.
„Sie können mich auch hier herauslassen.“
„Papperlapapp. Es ist schon spät und wir bringen Sie auf alle Fälle noch bis zu einer Stelle mit ÖPNV-Anschluss.“ Die wirr beschrifteten Schilder machen es den beiden Senioren nicht leicht. Ohne Navi und Karte befördert uns die Stadt ständig wieder aus ihrer Umlaufbahn. So dauert es fast eine Stunde bis wir Maastricht Hauptbahnhof erreichen.
„Ich möchte sie beide gerne auf einen Kaffee einladen. Doch es ist schon zappenduster. Und ich weiß ja, dass sie bald heim wollen. – Sagen Sie mir nur, wie kann ich mich bei ihnen revanchieren?“
Da entgegnet mir der alte Mann mit keckem Grinsen: „Ach wissen Sie, wenn Sie irgendwann mal Familie haben, ein wohlhabender Mann sind, wenn Sie mit ihrem Auto unterwegs sind und am Straßenrand einen armen Schlucker sehen, dann denken Sie an uns und nehmen ihn mit.“ Das sei ihnen Dank genug. Den Gefallen weiterschenken. Das Credo der Reisenden ...
Nur wenige Minuten später holt mich mein Freund ab. „Wie zum Teufel hast du das geschafft?! Als Tramper von Canterbury bis Maastricht an nur einem Tag?!“ Ich kann es ihm nicht erklären. Es hat alles mit einem Lächeln begonnen …
Glücklicherweise haben mir die beiden ihre Visitenkarte mitgegeben – Manfred und Waltraud. Gleich nach meiner Reise habe ich ihnen einen Brief nach Köln geschickt. Mit den schönsten Fotos meiner Reise und einem herzlichen Dankeschön. Seit nunmehr neun Jahren schreiben wir uns immer zu Weihnachten. Erzählen, was das Jahr über geschehen ist. In einem Jahr erfahre ich, dass der liebe Manfred verstorben ist. Doch Waltraud schreibt mir immer noch zurück. Nun seien es ihre Enkel, die die Welt erkunden. Auch dieses Jahr werde ich ihr wieder einen Brief schreiben.
Ein Sommer mit dir
Spanien 2017
Fünf Grad im Hunsrück. Ich will nicht zurück in den Winter. Um ein Haar habe ich das Boarding verpasst und presche durch den Flughafen, während die Morgensonne am Himmel glüht. Man kann sogar das Castillo in der Ferne sehen.
Plötzlich Tränen als ich in den Bus und dann in den Flieger steige, dieser vom Boden abhebt und mich mit jeder Minute immer weiter von dir fortträgt. Warum tut das schon wieder so weh?! Ein positiver Schmerz. Körper und Seele haben eben ihre eigene Art sich zu erinnern.
Ich beginne in meinem Kopf-Fotoalbum zu blättern. So vieles, was mir darin gefällt: Du in deiner Nixenpose auf den Steinquadern, während uns der Meereswind sanft über die Wange streicht, sich Wellen brechen und Möwen in den Wind stürzen. Du kopfüber auf der Schaukel. Später mit sandigen Zehen auf der Brücke. Unser Schattenspiel in der Höhle. Die duftenden botanischen Gärten. Der Tanz im Wohnzimmer. Die ungemeine Vertrautheit. Deine Pupillen, die sich schlagartig weiten, als ich fast gegen die Lampe stoße. Fußmassagen. Pianospielen im verlassenen Buchladen. Wie wir das Pärchen in dem Café heimlich portraitieren. Aktzeichnen. Yoga und Baden im Sonnenlicht. Flucht aus dem Karnevaltrubel. Jazz-Konzert. Lesen und Ukulele-Spielen am Strand. Ausschlafen. Dich anschauen. Einfach nur anschauen und in deinem Blick versinken. Das Gefühl innerlich zu schmelzen. Der Abend mit deinen Freunden. Das babylonische Sprachgewimmel, in dem du dich so wohl fühlst wie ein Fisch im Wasser. Deine Liebe zu Sprachen, Kunst und Menschen. Und dieser ungewöhnliche Kuss. Kopfüber. Wir allein auf dem Castillo. Nur das Meer aus Straßenlichter unter uns. Sich wagemutig in all diese Momente fallen lassen, wie die Möwen in den Wind …
Mi utopía es un verano contígo. Ich liebe es, wie herrlich chaotisch das Leben gerade spielt. Du hast mir gezeigt, wie auf diese Weise tanzende Sterne entstehen, die durch unsere Seelen ziehen. Bleibt mir nur ein „Farewell“ zu seufzen. Oder endlich zu schweigen und in den Winter zurückzukehren. Oder dir einfach nur zu wünschen, dass es dir gut geht. Pass gut auf dich auf, ja! Bis bald.
Durch die Wüste
Israel 2022
Wir rasten auf dem Machaneh Yehudah. Dem größten Markt in ganz Israel. Um uns wuselt es wie in einem Bienenstock. Stimmen, Gerüche, Waren. Ein orientalischer Bazar, in dem es alles zu geben scheint: Von der Kippa mit dem FC-Bayern-Logo bis zur Torte aus ‚Halva‘ - ein Mus aus Ölsamen, Zucker und Honig.
Während wir Schakschuka und Humus löffeln, deutet mein Freund Axel auf seine Handykarte: „250 Kilometer sind es von hier über das Tote Meer bis runter nach Mitzpe Ramon“, erklärt er, „Das sind etwa dreieinhalb Stunden auf dem Firehorse.“ Damit meint er seinen schwarzen Motorroller, den er liebevoll umgetauft hat, nachdem ich ihm erklärt habe, was es mit dem deutschen Begriff „Feuerross“ auf sich hat.
Mir wird schwindelig bei der Route. Dreieinhalb Stunden durch die Wüste bei schätzungsweise vierzig Grad. Schon jetzt im städtischen Getümmel von Jerusalem drückt die Sonne. Verbrennt mir an jeder Ampel erbarmungslos den Nacken. Daueralarm für meine Vampirhaut.
Ich trinke mein Wasserglas leer. Schaue bedröppelt auf das winzige Fläschchen mit Sonnencreme, das mir mein Mitbewohner Max noch mit auf die Reise gegeben hat. Nur für alle Fälle.
Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Motorrad-Schisser bin? Bis auf wenige Landstraßen früher mit meinem Vater habe ich null Erfahrung. Als Axel mich dann vorgestern das erste Mal auf den Highway mitgenommen hat, war das für mich wie Bungee-Jumping. Hinein in eine Welt aus Wind und dahinflutender Landschaft.
Ich, verkrampft hinten auf. Ein Menschenrucksack, nein, mehr hilfloses Fleischpacket, das sich machtlos an den Fahrer klammert und die härteste Übung in Meditation durchsteht. Denn wie bitte trickst du dein Gehirn aus, damit die Panikgedanken nicht überhandnehmen?
Ich liste also auf: Standstreifen. Baustellen. Autos. Verkehrsschilder. Liste alles auf, was ich sehe, spüre, rieche, höre. So rasend schnell, wie ich kann. Ein Wettrennen mit meiner eigenen Panik. Hebräische, Englische, Arabische Ortsnamen. LKWs. Gitter. Federn. – Waren das Hühner in dem Transporter? Strommäste. Autos. – Wenn ich mich zu weit rauslehne, bin ich tot. Na na na na … Kopfradio an. Gut so. Ja, ich erinnere mich ganz genau an diesen einen Song. Von Anfang bis Ende. Merke, wie es mich beruhigt. Hoffentlich läuft die Musik lange genug. Verdammt, ich brauche gleich ein neues Lied. Nein, eine ganze Playlist für mein Kopf-Radio …
Ich verliere das Zeitgefühl. Atmen. Ja, atmen ist gut. Fahrtwind. Kratzer im Helmvisier. Ein Friedhof aus Plexiglas. Für Käfer und Fliegen. Weiteratmen. Ruhiger werden. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Scheiße, sind die eingeschlafen? Wenn ich jetzt die Beine ausstrecke, was würde passieren? Zerraspeln meine Füße einfach auf dem Asphalt? Na na na na … Kopfradio lauter. Wind. Überall Wind. Ein Tunnel. Puh, wir werden etwas langsamer. Verflucht, mein Fuß wird steif. Weiter. Atmen …
Und irgendwann erreichen wir Jerusalem. Einen Ort, den ich nur aus Legenden kenne. Der Bibel. Dem Geschichtsunterricht. Und wie passend, dass ich diese Heilige Stadt in betender Haltung betrete. Mit gefalteten, schweißnassen Händen, um mich so auf dem Motorrad zu halten. Der Kopf voller Erleichterung und einem zynischen „Halleluja!“ diese Fahrt überlebt zu haben.
Aber ich möchte die Wüste sehen. Nicht mehr nur darüber lesen, hören, irgendetwas konsumieren, sondern sie selbst mit ganzem Körper und allen Sinnen erleben, durchleben, überleben …
Vermutlich ist das normal für ein richtiges, ein ‚echtes‘ Abenteuer. Also das, was alle immer predigen: Du musst aus deiner Comfort Zone. Dich einfach hineinstürzen. Zulassen, dass der Wahnsinn irgendwie seinen Lauf nimmt und das Ganze, so gut es irgendwie geht, genießen.
Also „Jalla!“, wie Axel sagen würde. „Los geht’s!“ Mit dem Firehorse schlängeln wir uns durch die vollgestopften Gassen. Ich versuche mich mit Axels Krücken zu arrangieren, die wir an seinen Roller festgesurrt haben. Vor ein paar Tagen hat er sich den Fuß beim Kite-Surfen verdreht und trägt das linke Bein seither in Schienen. Park-Spaziergänge sind zwar passé, aber für einen Motorrad-Höllenritt durch die Wüste ist es kein Hindernis.
Bevor wir Jerusalem verlassen, dreht Axel noch ein letztes Mal bei, als habe er etwas Wichtiges vergessen. In einem Kiosk kauft er uns eine zwei Liter Flasche mit Wasser. „Für den Worst Case – falls wir irgendwo in der Wüste stranden.“ Dann grinst er mir zu: „Nächster Halt: Der tiefste Punkt der Erde!“
Ein letzter Blick auf die Skyline – der Felsendom zu unserer Rechten. Dann senkt sich der Highway in die Tiefe durch Felsenschluchten, denn das Tote Meer liegt rund 430 Meter unter dem Meeresspiegel.
Plötzlich sind wir mittendrin in der judäischen Wüste. Felsen. Sand. Vereinzelt Sträucher. Wadis. Backofen-Luft. Mit unseren pechschwarzen Klamotten klebt sich die Hitze an uns fest. Sonne im Zenit. Alles hier will dich brennen sehen …
Wir rasten an der Kalia Beach. Am nördlichen Ende des Toten Meeres. Außer Touri-Busse und LKWs habe ich kein einziges Motorrad gesehen. Offenbar ist niemand so bescheuert wie wir hier rauszufahren.
Ein Kamel empfängt uns, das tapfer in der Sonne steht und recht unbeeindruckt davon wirkt. Ich reiße mir den Helm vom Kopf. Triefe vor Schweiß. Normalerweise schwitze ich kaum, aber die Sonne saugt uns aus wie Dörrobst. Trinkt uns leer. Unerbittlich. So muss sich ein Fisch anfühlen, der in ein kochendes Becken geworfen wird und weiterschwimmen muss. Hitze, Trägheit, Durst – das alles lässt sich für den Moment ertragen. Denn noch überwiegt die Begeisterung die Wüste endlich einmal selbst zu schmecken.
Wir betreten ‚The Lowest Bar in the World‘. Ich stürze eine zwei Literflasche in wenigen Zügen. Axel bestellt Eis. Dann warten wir. Sitzen einfach nur da. Für zwanzig Minuten. Völlig ausdruckslos und schlürfen unser Eiswasser. Bis die Gehirne wieder anfangen zu arbeiten.
Den Nachmittag verbringen wir am Toten Meer. Salz – zehnmal so viel wie im Ozean. Es lässt dich schweben, dringt dir in jede Pore, jede noch so kleine Narbe. Es beißt sich in deine nackten Füße, als würdest du über offene Herdplatten laufen.
Und weiter geht’s. Gegen 16 Uhr hat die Sonne bereits an Kraft verloren. Aber es ist noch ein langer Ritt bis Mitzpe Ramon. Die Maschine faucht auf und wir brettern über eine Serpentinen-Strecke Richtung Süden. Zu unserer Rechten: Die Steilhänge der judäischen Wüste in deren Schatten wir immer wieder eintauchen. Und links: Das Tote Meer, tief unten im Jordangraben. Ein gigantischer Riss in der Erdkruste. Seit 18 Millionen Jahren schrappt hier die Arabische Platte gegen die Afrikanische. Ich erkenne Berge auf der gegenüberliegenden Seeseite. Das muss Jordanien sein.
Nur fürs Protokoll: Motorräder sind mir immer noch suspekt, aber auf diese Weise mit dem Firehorse durch die Wüste zu kurven ist „fucking awesome“. Statt isoliert in einem fahrenden Buskühlschrank vor sich hinzufrieren, spüren wir die Landschaft. Die Vibration der Straße. Wie sich der Highway an die Abhänge schmiegt. Mir bleibt gar keine Zeit mehr in Panik zu verfallen …
Dann rasten wir. Saugen das Panorama auf. Lauschen. Wenn die Autos verschwinden, senkt sich eine Stille über die Weite, wie ich sie nicht kenne. Natürlich bleiben vereinzelte Vogelrufe. Das Knistern der Hochspannungsleitung. Aber die Stille ist so tief, dass wir jede unserer Körperbewegungen wie durch ein Mikrophon wahrnehmen.
Und weiter geht’s. Wir passieren die Grenzkontrolle – raus aus dem Westjordanland, zurück nach Israel. Vorbei an Wüstendörfern. Militär Areale. Kamel Farmen. Salzbänke, auf denen Menschen ins Meer vorlaufen, als würden sie auf dem Wasser gehen. Am südlichen Ende erhebt sich eine Fabrikstadt aus dem Sand, die gleich einem Stahlungeheuer Salz und Magnesium aus der Erde schürft.
Wir tanken ein letztes Mal voll, denn nun geht es so richtig hinein in die Negev. Die Luft wird staubtrocken. Felsen glühen von der Nachmittagssonne. Immer tiefer tauchen wir ein in die verschlungenen Canyons.
‚Negev‘, das kommt aus dem Aramäischen und heißt ‚vertrocknetes Land‘. Alles Leben hier ist ein ‚Trotzdem‘. Ein stummer Protest. Purer Ausdruck von Überlebenswille.
Als wir einen LKW passieren, schmettert sich plötzlich ein Gewicht gegen uns, als würde sich ein unsichtbares Tier gegen das Motorrad werfen. Für den Bruchteil einer Sekunde verlieren wir das Gleichgewicht. Axel reißt den Lenker herum. Stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Ich verkrampfe, doch er hält das Firehorse stabil.
Das war der erste Vorbote von dem, was uns erwartet: Wind. Mit der Dämmerung stürzt er uns von allen Seiten entgegen. Schüttelt uns durch. In unberechenbaren Stößen. Er heult durch die Felsspalten. Strömt an den Canyons vorüber. Autos und Busse peitschen ihn uns um die Ohren. Sturzbäche, Fluten aus Wind.
Dreimal sehen wir die tiefrote Sonne hinter den Felsschluchten unter- und wieder aufgehen. Bis sie endgültig verschwindet.
Axel beschleunigt, um die Böen wie ein Messer zu durchschneiden. Alles vibriert. Nach stundenlanger Fahrt verkrampft sich mein Körper immer mehr bei dem Versuch unserem unsichtbaren Gegner Stand zu halten. Ich kann einfach nicht mehr und mache das vereinbarte Zeichen für ‚Anhalten‘, indem ich Axel auf die Hüfte klopfe.
Wir rasten. Streifen uns Pullis über, weil es doch allmählich frisch wird. „Jetzt kennst du die Erzfeinde der Motorradfahrer“, erklärt er mir, „Regen, Schlaglöcher, Wind, Nacht.“ Dabei zieht er an seiner Zigarette. Schaut mich mit einer tiefen Ruhe an.
Ja, denke ich, er ist wirklich ein Mensch der Geschwindigkeit. Ganz bei sich, wenn die Landschaft an ihm vorüberströmt. Und seine Gelassenheit lässt auch mich ruhiger werden. Seit fast vier Stunden donnern wir hinein in diese ungeheure Leere. Eine Weite, die kein Erbarmen kennt. Und doch hält er mich fest mit seinem Lächeln.
Weiter geht’s. Mittlerweile hat die Dämmerung die Berge verschlungen. Schatten werden zu Silhouetten und verschmelzen mit der absoluten Dunkelheit. Die Straße: Nur noch eine gestrichelte Linie, auf der uns der Wind durchschüttelt und Schlaglöcher im Lichtkegel entgegenblitzen. Selbst die Autos der Beduinen sind nicht mehr unterwegs. Wir sind alleine.
Meine Augen klammern sich an jedes Licht, das am Horizont aufleuchtet. Mit jedem Funke keimt und stirbt die Hoffnung, dass wir endlich da sind. Weiter. Nur noch ein Stück. Irgendwo da draußen muss sie schließlich sein. Die Stadt in der Wüste. Nur weiter. Immer weiter …
Ich seufze, als wir endlich den Highway verlassen und ich die Aufschrift „Mitzpe Ramon“ lese. Axels Freund Reem empfängt uns vor seiner Wohnung. „Ich dachte, ihr kommt mit dem Bus“, ruft er uns zu, „Ihr seid ja total verrückt!“ Ich werfe einen Blick rüber zu Axel, der wie ich erschöpft in sich hineinlächelt. Auch für ihn mit seinen vielen Jahren Erfahrung war es die intensivste Motorradfahrt seines Lebens. Wir teilen ein Geheimnis, das sich schwer in Worte fassen lässt. Es hat mit der Wüste zu tun. Ihrer Leere. Und unserem tiefen Vertrauen ineinander, dass wir irgendwann ankommen werden.
Nach Norden
Skandinavien 2022
Ich nehme den Nachtzug bzw. Nattåg von Stockholm nach Boden. Bereits am Gleis springen mir eine Hand voll Backpacker ins Auge, die wie ich auf die Lofoten wollen. Andere zieht es nach Abisko, um den Kungsleden (Königsweg) durch Lappland zu wandern. Viele Deutsche darunter. Aber auch Einheimische auf dem Weg Richtung Norrland, dem nördlichen Teil Schwedens.
Das erste Wort, das mir zu meinem Abteil einfällt, ist eines, das ich in Israel kennen und lieben gelernt habe: ‚Balagan‘. Es bedeutet so viel wie Tohuwabohu, Chaos oder Durcheinander. Ich finde Balagan klingt nur schöner.
Der Zug holpert los durch die Dunkelheit. Inzwischen sind wir fünf Herren. Ich würde sagen, die Altersspanne reicht von 18 bis 70. Bald bauen wir das Abteil schlaffertig. Klappen die Bettgestelle aus. Sechs Stück. Jeweils drei übereinander. Da keiner Ansprüche erhebt, schnappe ich mir eines der unteren. Immerhin ist dann die Fallhöhe nicht ganz so groß.
Die anderen Gentlemen roden in dieser Nacht nur kleine Wälder. Einmal fährt jemand unruhig aus dem Schlaf hoch. Ein anderes Mal fallen dem Jungen über mir die Kopfhörer runter. Wenn du im Dreier-Stockbett unten schläfst, kommt dir alles entgegen.
Es ist ein Hostel auf Rädern. Alles quetscht sich. Gerüche von fünf Menschen wabern in der Kabine. Bis morgens einer nach dem anderen aussteigt …
„Hast du das Schild gesehen?“, meint mein letzter verbliebener Sitznachbar Victor, „Wir haben soeben den Polarkreis überschritten.“ Also 66,57 Grad nördliche Breite. Auf diesem Kreis geht die Sonne zur Sonnenwende nicht mehr auf bzw. unter. Wir betreten das Land der Mitternachtssonne und der Weißen Nächte.
Immer wieder kommen uns Güterzüge entgegen, beladen mit tonnenweise Erz. „Hier oben gibt es gewaltige Minen“, meint Victor, „Sogar ganze Städte unter der Erde mit Shops und Straßen.“
Nebel zieht auf und umwabert Berge von abgebautem Gestein. Ich lese, dass Kiruna nicht nur die nördlichste Stadt Schwedens ist. Hier befindet sich auch die größte Eisenerz-Mine der Welt. Rund 24 Millionen Tonnen Roherz werden hier jährlich aus der Erde geschürft. Paradoxerweise begründet der Abbau nicht nur die Stadt, er gefährdet sie auch. Etwa durch Erdbeben, die damit in Verbindung stehen. Darum gibt es Überlegungen, die Stadt in wenigen Jahren zu ‚verschieben‘.
Was nun folgt, zählt zu den schönsten Bahnfahrten meines Lebens. Einmal quer durch Skandinavien – durch Lappland. Riesige Felsen und Küstenstreifen. Diese Farben. Diese ungeheuren intensiven Herbstfarben. Fünf Stunden klebe ich am Fenster und kann mich nicht sattsehen. Schließlich passieren wir die Grenze nach Norwegen. Die Zugstrecke senkt sich, denn unsere Endstation Narvik liegt an der Küste. Immer wieder heult die Zugpfeife auf und wir donnern durch Tunnel. Gewaltige Fjorde tun sich auf. Wasserfälle, die über Abhänge strömen. Ins Meer – die Norwegische See.
In Narvik enden die Schienen. Fast alle, die aussteigen, tragen schwere Wanderrucksäcke. Die Hafenstadt bildet das Tor zu den Lofoten.
Kurz vor Mitternacht zieht es mich vor die Tür meines Hotels. Vermutlich erhoffe ich mir zu viel, aber ich würde zu gerne Nordlichter sehen. Leider ist der Mond recht hell. Stadt und Hafen strahlen tausende Lichter in die Nacht. Wolken, die milchig zwischen den Sternen dahinwabern. Ich laufe die Straße hoch und entdecke einen Aussichtspunkt. Mache mir den Nacken krumm und möchte gerade aufgeben, da zieht ein blassgrünlicher Faden über den Wolken hinweg. – Grundgütiger, Fäden aus Licht. Eindeutig. Nur für Sekunden wie von göttlichen Pinselstrichen ans Firmament gemalt und dann wieder verschwunden.
Ich lache. Weine vor Glück. Weil es mich an unser Hörspiel über die Antarktis erinnert. Weil mich die Sehnsucht nach diesem Phänomen in den Norden gelockt hat. Weil es so unwahrscheinlich ist das zu beobachten und alle Faktoren stimmen müssen – Sonnenwind, Ort und Wetter. Weil ich diese Reise für mich unternehme. Ganz für mich allein.
Aurora borealis. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Wenn auch nur für einen kurzen Moment.
Kreuzfahrt
Skandinavien 2022
Nach Hitchhiking, Zug, Bus, Flugzeug, Steckenpferd wähle ich heute die vielleicht versnobteste Art zu reisen: Die Fähre von Oslo nach Kiel. Besser gesagt die günstigste (und immer noch schweineteure) Kabine auf diesem Reederei-Monster. Denn ‚Fähre‘ scheint mir völlig untertrieben. Mehr schwimmendes Luxushotel. Ein Kapitalismus-Palast mit Wasser unterm Kiel. Ich sollte bald in Regenwald-Wiederaufforstung investieren, um mein Gewissen reinzuwaschen.
Noch nie war ich auf so einem großen Dampfer. Teufel, dieses Ding besitzt im Inneren eine Vergnügungsmeile mit Bars, in denen sogar Live-Musik spielt. Meine Kabine hat sogar ein Fenster mit Blick auf diese schillernde, künstliche Innenwelt.
Ich bin fasziniert und überfordert zugleich, wie dieses Kreuzfahrtschiff ‚Vergnügen‘ definiert: Angefangen von Shopping-Möglichkeiten bieten sich dem neoliberalen Geist Restaurants aller Art: Vom Italiener, Irish Pub, Sushi Tempel, American Diner, bis hin zum Bankettsaal am Heck des Schiffs, den ich mich nicht traue zu betreten. Ohne Anzug und Krawatte werfen sie mich Zipphosen-Lump gewiss über Bord. Vorne am Bug fährt das Casino voraus. Stilvoll. Eine ganze Etage bietet Konferenz-Räume. Whiteboards und Kaffee im Überfluss. Hier finden die Geschäfte statt. Aber welche Firmen tagen bitte auf See? Nicht mal der Wellengang ist spürbar. Nur der subtile Herzschlag der Turbinen. Verstohlen packe ich meinen Proviant aus, um an Bord autark zu leben. Ein Spaß ist das hier. Ein teurer Witz auf Kosten der Umwelt.
Ich frage mich, was auf meinem eigenen Vergnügungsdampfer los wäre. Ein Theater und Kinosaal. Offene Ateliers und Ausstellungsräume. Ein Yoga und Meditationsraum. Eine Bibliothek mit gemütlichem Lesesaal. Ein eigener Radiosender. Es gäbe einen großen Garten auf dem Oberdeck und Solaranlagen zur Energiegewinnung. Es würde aus wiederaufbereiteten Materialien bestehen und CO2-neutral fahren. Kabinen mit Hängematten. Kein Fleisch an Bord. Unterkünfte, die sich alle leisten können. Und es wäre bunt angestrichen. Voll mit Graffitikunst, die auch übersprüht werden darf.
Fühle mich fiebrig. Mein Körper kämpft gegen irgendeinen Virus, den ich mir vermutlich auf der Zugstrecke Bodø – Trondheim eingefangen habe. Trotzdem stapfe ich müde ans Oberdeck. Einen Sonnenuntergang auf offener See lasse ich mir nicht entgehen. Kaum Menschen hier. Ist es den meisten zu windig? Sind sie alle in der Vergnügungsmeile? Ist ein Sonnenuntergang weniger reizvoll, nur weil er nichts kostet?
Es muss noch ein anderes Schiff geben. Ein Verborgenes. Eines, durch das die Bediensteten gehen. ‚Staff Only‘. Mit Küchen, Lebensmittel-Kammern, Container-Ladungen, kleine Schlafkabinen mit Klappbetten. Das hier ist nur die Vorderbühne. Hier spielt die Luxus-Show. Wie gerne ich einen Blick dahinter werfen würde.
Zwei einsame Musiker tragen in der Bar zum Ambiente bei. Eine Sängerin / Saxophonistin und ein Pianist, die simple Jazz-Folgen zu einem vom Band kommenden Schlagzeug-Bass-Rhythmus trällern. Lieblos. Seicht. Trotzdem höre ich zu. Setze mich zwischen all die Senioren.
Ich glaube, im Moment bin ich der einzige aktive Zuhörer. Alle anderen sind ins Plappern und Schnattern vertieft. Darum falle ich wohl auch direkt den Musikern auf. In den Pausen zwischen den Songs schauen sie zu mir rüber. Wie gerne ich mich mit ihnen unterhalten und sie fragen würde, wie es ist Musiker auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein.
Ich hätte nur etwas warten müssen. Bis zur letzten Nummer. Hätte sie skizziert und wäre dann mit der Zeichnung auf sie zugegangen. Ein kreativer Eisbrecher. – Aber ich fühle mich fiebrig, sodass ich mich nach ein paar vergeblichen Bleistiftstrichen aufraffe zu meiner Kabine. Ein kurzer Wink zum Abschied. Die Sängerin strahlt und erwidert den Gruß. Ja, an dieser Begegnung muss ich wohl vorbeiziehen.
Der größte Vorteil eines Kreuzfahrtschiffes ist vermutlich, dass es die Unannehmlichkeiten der Fortbewegung kaschiert. Du lebst in einer schwimmenden Stadt und kannst sogar abends spazieren gehen, was ziemlich ulkig ist in einer Haremshose, wenn alle anderen Abendgarderobe tragen.
Doch so gerne ich diese absurde Welt näher erkunden möchte, gebe ich meinem Körper wonach er verlangt. Schlaf in Unmengen. Zeit nicht mehr dagegen anzukämpfen.
Am Morgen ist die Restaurantmeile leergefegt. Vögel zwitschern aus Lautsprechern. Als ob es nicht schon absurd genug wäre. Auf dem Oberdeck packe ich mein Frühstück aus. Genieße mein autarkes Leben, Sonne und Baltisches Meer. Der Schlaf hat gutgetan. Kein Fieber mehr. Nur beim Anblick der Heckwelle wird mir schlecht. Ein aufgewühlter Streifen, der bis zum Horizont reicht. Wir durchpflügen das Meer. Zerteilen es wie eine Autobahn das Hügelland. Wie das wohl Unterwasser donnert? Schall breitet sich hier rund fünfmal schneller aus als in der Luft. Über hunderte Kilometer der Lärm von Motoren und aufgewühltem Wasser.
Schließlich erreichen wir den Hafen von Kiel und ich beobachte fasziniert, wie sie dieses Hotel einparken. Ein paar Möwen kapern bereits das Oberdeck. Ihr Gefieder weiß, wie ich es kenne. In Norwegen leben andere Möwenarten.
„Hallo!“, kreischt ein Chor aus Kindergartenkinder, die vor dem Schifffahrtsmuseum stehen. Ich rudere mit den Armen und sie winken zurück. Im Bauch des Schiffes drängen sich bereits die Senioren. Wer nicht von Bord geht, hat drei Stunden, um sich in einer Stadtführung herumkutschieren zu lassen. Ein letzter Blick in den toten Irish Pub, so authentisch, wie das Vogelgezwitscher aus den Boxen, dann gehe ich über die lange Rampe von Bord. Begleitet von authentisch-seemännischer Akkordeon-Musik.
Am Bahnhof muss ich über einen Werbespruch lachen, der auf einem Waggon klebt: „Schleswig-Holstein. Der echte Norden.“ – Wirklich jetzt?! Tagelang bin ich von Narvik über die Lofoten, Bodø, Trondheim, Oslo in den Süden gereist, um endlich im „echten Norden“ angekommen zu sein? Ganz im Ernst, noch nie ist mir Norddeutschland so südlich vorgekommen wie heute.
Impfcocktail
Deutschland / Nepal 2023
Mir ist klar, dass ich mich auf Nepal intensiv vorbereiten muss. Alles, was ich bislang gelesen habe, führt mir das vor Augen und ich scherze bisweilen: „Als würde ich ein Buch mit dem Titel ‚One Hundred Ways to Die in Nepal‘ lesen.“ Der Smog in Kathmandu, Darmkrankheiten, tollwütige Affen, Monsunregen, Erdrutsche, Höhenkrankheit. Ein Traum …
Warum sich das geben? Ich habe Lust auf den Kulturschock. Das erste Mal Asien. Eine andere Mentalität kennenlernen. Die letzten Jahre habe ich Gefallen an der buddhistischen Philosophie gefunden und es reizt mich in eine Kultur einzutauchen, in der das zum Großteil gelebt wird.
Der Weg nach Asien führt in Mainz über den trostlosen Siebten Stock eines Unimedizin-Betonklotzes. Darin untergebracht: Die Tropenimpfung-Beratungsstelle.
„Tollwut ist immer eine Entscheidungsfrage“, beginnt die Ärztin das Gespräch. Ich entgegne:
„Nun ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein tollwütiger Affe beißt, schätze ich ehrlich gesagt sehr gering ein.“
„Die wilden Hunde sind das Problem. Nach einem Biss bleiben Ihnen nur 24 bis 48 Stunden für die Antikörper-Dosis. Die bekommen Sie allerdings nur in Kathmandu.“ Das alles schildert sie, ohne die Miene dabei zu verziehen. „Ansonsten wird es, sagen wir, ziemlich aussichtslos für Sie.“
Ich nicke. „Gut, Sie haben mich überzeugt.“
Später finde ich immer mehr Gefallen an ihrer trockenen, pragmatischen Art. Eine Tropenärztin, die den feinen Unterschied zu kennen scheint zwischen Luxus-Wehwehchen und ernsthaften Problemen: Spätmonsun? – Ach, nur etwas Regen. Bettwanzen? – Einfach einen Seidenschlafsack benutzen. Leichter Durchfall? – Der einheimische Tee verschafft Linderung. Höhenkrankheit? – Langsam die Berge hinauf und nicht fliegen. Schuhe unbedingt einlaufen. Blasenpflaster nicht vergessen. Mückenspray im tropischen Süden. „Ich habe damals den Annapurna Circuit gemacht. Ohne Training. Ist ganz nett da. Diese alten Tibetischen Klöster. Gigantische Berge. – Das hat echt was.“
Zwei Injektionen später mache ich mich auf. Rechter Arm: Tollwut. Linker: Japanische Enzephalitis. Die nächsten vier Wochen warten noch zweimal Tollwut, einmal Japanische, einmal Hepatitis A und Typhus und einmal Hepatitis B auf mich. – Juhu! Hoffe, die Krankenkasse spielt mit. Andernfalls wird das der teuerste Cocktail meines Lebens.
Zwei Jungs aus Bodnath
Nepal 2023
„Erinnerst du dich an mich?“, werde ich von einem kleinen Jungen angesprochen. Es ist Badal, ein 15-Jähriger, mit dem ich bereits vor wenigen Tagen hier an der Bodnath Stupa ein kurzes Gespräch geführt habe. „Das hier ist mein Cousin Krish. Wir gehen beide auf die Thangka-Kunstschule und haben heute frei. Magst du es dir mal anschauen?“
Dort erklären mir die zwei, wie sie die Leinwände herstellen und bespannen. Aus welchen Mineralien die Farben hergestellt werden. Thangkas sind rituelle Gemälde, die zum Beispiel Mantras zeigen und auf künstlerisch eindrucksvolle Weise buddhistische Ideen zum Ausdruck bringen. Etwa den Aufbau des Geistes, einer Stupa oder gleich des gesamten Universums. Dabei sind die Gemälde so fein gemalt, dass der Herstellungsakt alleine einer Meditation gleichen muss. „Für ein solches sitzt man schon mal drei Monate.“
Die Ausbildung zur Thangka-Künstler:in vollzieht sich wohl über mehrere Stufen. Es dauert bis zu zehn Jahre den Grad der Meisterschaft zu erlangen. Natürlich geht es am Ende des Vortrags wieder um Geld. Ich beteuere wahrheitsgemäß nicht genug für ein Gemälde dabei zu haben, gebe der Schule jedoch eine großzügige Spende.
Auf einmal fragen mich die beiden Jungs, ob ich ihren Familien etwas zu essen kaufen möchte. „Mein Vater hat kürzlich einen Großteil seiner Einnahmen verloren. Schon ein wenig Reis würde uns helfen.“ Weil ich die zwei längst in mein Herz geschlossen habe, gehe ich mit ihnen zum Supermarkt. Bei jedem Lebensmittel fragen Sie höflich nach: „Diese Ölflasche? Ist das in Ordnung, Sir?“ Ich nicke immer wieder verlegen. „Und diese große Reispackung?“
Es ist nichts Außergewöhnliches an der Bestellung. Absolute Basics, um für ein paar Tage zu überleben. Der Kauf summiert sich. Selbst für mich ist es viel, aber ich zahle gerne. Die beiden können es gut gebrauchen. „Das ist so freundlich. Wir würden Sie zum Dank gerne auf einen Tee einladen.“ Wieder zögere ich. Meine Intuition sagt mir jedoch, dass ich den beiden Jungs vertrauen kann. Außerdem brauchen sie Hilfe, um den ganzen Einkauf heimzutragen.
„Es ist nicht weit von hier.“ Sie führen mich in die Slums von Bodnath. Hunderte verdutzte Gesichter starren mich an, die ich mit einem beherzten „Namasté“ zu einem Lächeln bewege. Krish lacht. „Wissen Sie, Sir, noch nie hatten wir einen westlichen Besucher hier in unserem Viertel zu Gast.“
Ich betrete einen dunklen, fensterlosen Raum, der vermutlich acht Quadratmeter fasst. Hier lebt Krish mit seinem Bruder, seinen Eltern und seiner altersschwachen Großmutter zusammen. Ein Gaskocher am Eingang. Teppiche anstelle von Betten. Das war's. Ich bin noch nie zu Gast gewesen bei einer so armen Familie, grüße die beiden älteren Damen und lasse Krish Dankesworte für die Gastfreundschaft übersetzen.
Die Mutter kocht uns Tee, während wir uns unterhalten. Der beste Masala, den ich je getrunken habe. Ich zeige ihnen mein Reisetagebuch. Sie sind ganz fasziniert von meiner Handschrift. Dann schenke ich meine beiden Gebetsschals (Khatas) weiter. Für einen buddhistischen Haushalt ein Zeichen für Glück. Krish erzählt, dass sie vorher eine größere Wohnung hatten, die jedoch vom Erdbeben zerstört wurde. Es berührt mich zutiefst, was diese beiden Jungs schon alles in ihrem kurzen Leben an Armut und Verlust erfahren mussten. Genug, um zu verbittern. Stattdessen bringen sie mir höchste Gastfreundschaft und Neugier entgegen. „Weil wir Buddhisten sind, Sir. Wir glauben an das gute Karma.“
Am Ausgang drücke ich der Mutter noch einen hohen Rupienschein in die Hand, was für die monatliche Rente reichen sollte. Die Jungs bringen mich noch zurück zur Stupa, damit ich nicht verloren gehe. Krish liebt indische Filme und empfiehlt mir direkt zwei seiner absoluten Favoriten. „Die Amerikanischen sind uns leider meist zu teuer. Aber Avatar 2 habe ich sogar gesehen.“ Wir verabschieden uns. Auch ich bin den beiden Jungs sehr dankbar. Über diese Begegnung werde ich noch sehr lange nachdenken …
Als ich im Guesthouse ankomme, starre ich ganz irritiert auf mein Gästezimmer. So viel Platz für einen einzigen Menschen. Viel mehr als diese Familie besitzt. Ich bin zurückgesprungen in meine heile Luxuswelt. Nur dass der Schleier zur Realität da draußen deutliche Risse bekommen hat ...
Die beiden Globetrotterinnen
Nepal 2023
Wir laufen an Erdrutschen vorbei. Hinein in einen tropischen Dampfkessel. Zu unserer Linken brodelt der Modi Khola Fluss, der dieses Tal zerschneidet. Der Dunst raubt uns alles an Energie. Hitze. Unerträglich. Sie staut sich in der feuchten Luft, wie in einem Kochtopf. Alles klebt. Ein Schritt. Noch einer. Die Gedanken kleben an jedem Schritt. Wieso in die Tropen?, frage ich mich wie im Fiebertraum. Wie bin ich nochmal in den Tropen gelandet? Eine Stufe. Noch eine. Dabei ist das hier unter Himalaya-Bedingungen nur ein Hügel.
„Achtung, Blutegel an deinem Schuh!“, ruft Binod, mein Guide. Ich hätte dieses winzige Würmchen glatt übersehen. Es windet sich blitzartig in jede noch so kleine Öffnung. Was für scharfe Augen er doch hat.
Wir überqueren den schäumenden Gebirgsfluss an einem Ort mit der prägnanten Bezeichnung ‚New Bridge‘. Gleich zwei Hängebrücken stehen hier bereit, wobei ich froh bin über das neue Fabrikat. ‚Old Bridge‘ kracht bereits beim Hinsehen auseinander.
Weitere hundert Meter hinauf wartet eine noch mächtigere Brücke. In schwindelerregender Höhe verbindet sie zwei Talseiten. Nun wandeln wir nicht mehr unter, sondern auf den Gebetsfahnen.
Sieben Laufstunden haben wir heute bereits zurückgelegt, doch bis Chhomrong, unserem Tagesziel, sind es noch weitere eineinhalb. Ein reiner Aufstieg. Nur Treppen. „Das machen wir aber nur, wenn du dich fit genug fühlst. Wir müssen hier keinem etwas beweisen.“ Also horche ich noch einmal tief in mich hinein, massiere meine tapferen Beine und nicke ihm dann zu: „In Ordnung, lass uns da raufgehen.“
Los geht's ins Reich der endlosen Treppe. Es wird etwas angenehmer, weil weniger schwül. Größere Trittsicherheit, wenn dir kein Abgrund entgegengrinst. Fast 800 Meter geht es hinauf. Hoffentlich bleibt es trocken. Wir überholen eine Gruppe Träger, die dicke Stahlteile diese Endlostreppe hinaufschleppen. Unfassbar, wie sie das bewerkstelligen. Auch sie folgen offenbar ihrem Rhythmus.
„Was glaubst du, kommt diese Regenwand da vorne auf uns zu?“ Wie zur Antwort melden sich erst dicke Tropentropfen. Bis mir Binod zuruft: „Zeit für die Regenschirme!“ Der Monsun trifft uns mitten im Aufstieg. Haltmachen ist auf dieser Steiltreppe unmöglich. Uns bleibt keine andere Wahl als uns weiter hinaufzukämpfen. Auf glitschig-nassem Geröll. Schritt für Schritt. Regenschirm in der Rechten, Wanderstock in der Linken. Ich zügle meine Angstgedanken. Irgendwann müssen wir schließlich oben ankommen. Einfach weiter. Eine Stufe. Noch eine ...
Auf dem Hügelgipfel bricht die Sturzflut so heftig über uns herein, dass ich das Gefühl habe, der Himmel fällt uns buchstäblich auf den Kopf. Wir flüchten uns in die erstbeste Lodge, die unseren Weg kreuzt. Teufel, wir haben‘s endlich geschafft. Was für ein Gewaltmarsch.
Nach einer warmen Dusche und einem guten Abendessen fühle ich mich bereits wieder wie ein Mensch. Auch eine andere Touristin, sehr jung, hat sich in die Unterkunft geflüchtet. Wie ich kritzelt sie in ihrem Tagebuch und stellt sich mir als Callie vor. Sie komme aus den USA und reise seit Jahren allein über den Globus. „So einen Marsch wie heute habe ich allerdings noch nie erlebt! Bin von Ghandruk aus hierher und musste einen aktiven Erdrutsch hinaufklettern. So froh, dass ich lebend angekommen bin.“
Am nächsten Morgen sind wir beide pünktlich zum Sonnenaufgang wach. Früh aufstehen lohnt sich in Nepal, da zu dieser Uhrzeit die Sicht meist am klarsten ist. Wir schauen fasziniert in die gewaltigen Täler, die wir uns gestern hochgeschuftet haben. Vor uns: Der gewaltige Gipfel von Annapurna South. Und rechts davon Mount Fishtail, den die Einheimischen Machapucharé nennen. Zu dieser Morgenstunde glüht er in einem fast überirdischen Licht. Immer mehr begreife ich, warum diese Giganten den Mythen zufolge als Sitz der Götter gelten.
Callie hat größte Freude mit ihrem Teleobjektiv. Sie erzählt mir, dass sie ihre nun schon vier Jahre andauernde Reise über Gelegenheitsjobs finanziert. Fotos und Imagefilme für Unterkünfte. Außerdem arbeitet sie als Produkt-Influencerin. Mittlerweile träumt sie davon sesshaft zu werden. „Kapstadt soll sehr schön sein“, meint sie, auch wenn sie noch keinerlei Bezug habe zu diesem Ort.
Was mich am meisten vom Hocker reißt, ist ihr Alter: 19 ist sie und lässt sich meiner Ansicht nach so unerschrocken durch diese Welt treiben, als gäbe es keinerlei Gefahr, die sie nicht meistern kann.
Callie geht nicht darauf ein, dass wir sicherer zu dritt weiterlaufen können. Unsere Wege kreuzen sich zwar immer wieder auf dem Trek hinauf zum Annapurna Base Camp. Doch sie möchte alleine wandern.
„Was glaubst du, warum sie in ihrem Alter keine Ausbildung oder ein Studium macht?“, fragt mich Binod später. „Wie leistet sie sich die Flüge? Wo glaubst du hat sie ihre Wurzeln?“
Ich merke, wie er als junger Vater dabei an seine eigenen drei Kinder denkt. Familienzusammenhalt ist für ihn alles. Callie ist allein auf diesem Himalaya-Trek. Man kann es als mutig bezeichnen oder äußerst leichtsinnig. Binod zieht Bilanz: „Sie hat gesagt, dass sie offline unterwegs ist. Wenn ihr etwas zustößt, so wird es Tage oder gar Wochen dauern, bis jemand nach ihr suchen geht. Ohne Guide und Kontaktperson ist sie völlig auf sich allein gestellt. Überleg mal: Wir sind zu zweit. Du hast ein Netzwerk zuhause. Wenn dir etwas geschieht, dann wird es keine 24 Stunden dauern, bis sie nach dir suchen …“
Es ist nicht das erste Mal auf dieser Reise, dass mir das Alter einer Backpackerin extremen Eindruck macht. Vieles an Callie erinnert mich an eine Begegnung im Bodhi Guesthouse, Kathmandu. Dort habe ich eines Abends Ruth kennengelernt. Eine alte Dame, Jahrgang 1943, die gerade darauf gewartet hat, dass ihr gekochtes Essen kalt wird. Sie ist eine 80-jährige Hippie Lady, kommt ebenfalls aus den USA und lebt ihr ganzes Leben schon aus dem Koffer. Europa, Marokko, Indien, Nepal ... „In Asien gefällt‘s mir am besten, weil es sich mit wenig Geld gut leben lässt und die Menschen alle freundlich sind.“
Wie Callie wäre sie eine Fundgrube für jeden Dokumentarfilm. Ruth war bei der YMCA-Bewegung dabei und lebte lange als Tai Chi- und Karate-Lehrerin. „Mittlerweile bastle und verkaufe ich allerlei Kunstgegenstände. Und luchse der US-Regierung alles ab, was ich an Rente kriegen kann. Die haben ohnehin viel zu viel Geld.“
Ich besuche sie öfter in ihrer Unterkunft auf der Dachterrasse des Guesthouse. Erfreue mich an ihren unzähligen, verrückten Lebensgeschichten: Wie sie als junge frau Malaria überlebt hat. Wie sie seit Jahrzehnten Traumtagebuch führt. Wie sie erst einen Bergsteiger, später einen spanischen Hippie heiratete und schließlich das Eheleben vollends aufgab. „Mittlerweile habe ich meine ganze Familie überlebt. Nur noch eine Handvoll Freunde sind übrig, denen ich ab und an eine Mail schreibe.“ Ihr Plan ist es bald zum Everest Base Camp zu laufen. Ohne Guide, denn das sei ihr zu unnötig und viel zu teuer.
„Weißt du, es kommt nicht oft vor, sich mit einem so intelligenten jungen Menschen zu unterhalten. In der Regel bin ich auch viel zu schüchtern.“
Warum ich beide Begegnungen zueinander in Beziehung bringe? Sie haben mir vor Augen geführt, dass Reisen in jedem Alter möglich ist. Offenbar musst du nur gesund und unerschrocken genug sein und aus einem wohlhabenden Land kommen.
Vermutlich tue ich beiden mit meiner Küchenpsychologie Unrecht, doch mir ist aufgefallen, dass sowohl Ruth als auch Callie eine gewisse Aura der Einsamkeit umgibt. Obwohl beide so viel gesehen haben, blitzt aus ihren Erzählungen immer wieder etwas Melancholisches auf. Ich vermute, es ist die tiefe Sehnsucht nach einem Ort mit vertrauten Menschen, an den sie zurückkehren können.
Annapurna Base Camp
Nepal 2023
Ich träume, dass ich am Vorabend einer Tagung noch schnell eine Präsentation vorbereiten muss. Stressiges Gefühl. Dann jedoch aufzuwachen und sich in einer nepalesischen Berghütte über 2.500 Meter wiederzufinden, ist ein ganz schön befremdlicher Kontrast. Der Traum stammt aus einer anderen Welt. Hier gibt es kein PowerPoint. Es geht um viel grundlegendere Dinge: Hat der Regen aufgehört? Sind die Klamotten etwas trockener geworden? Wird mein Körper den heutigen Aufstieg meistern?
Es ist noch feucht draußen als wir aufbrechen. Da sich das Himalaya-Tal nun immer weiter zusammenzieht, wirkt der Urwald unheimlich dunkel. Immer wieder machen wir halt und bestaunen die schönsten Wasserfälle, die ich je gesehen habe. So gewaltig hoch, als würden sie vom Himmel herabströmen. Je mehr die Sonne hervorkommt, desto deutlicher zeichnen sich die Konturen der gewaltigen Felswände ab, die uns immer weiter einkesseln.
Das hier ist sie also, die Treppe hinauf zum Dach der Welt. Stelle dir endloses Geröll vor. Sieben Stunden Aufstieg und dabei ein Höhenunterschied von 1,5 Kilometer. Bin ich froh, wenn wir das heil überstehen.
Wir rasten in einer Höhle. „Vor 30 Jahren, als es hier noch keine Unterkünfte gab, haben die Reisenden hier die Nacht verbracht“, erklärt mir Binod. Von hier können wir wieder den Machapucharé sehen, Mount Fishtail. Ich weiß nun, dass es verboten ist, diesen zu besteigen, weil er als heilig gilt. Vermutlich wurden bislang nur illegale Versuche unternommen. Innerhalb weniger Minuten ziehen gewaltige Wolkenmassen das Tal hinauf. Keine Frage, die Welt, die wir betreten, ist nicht nur das Reich der Berggötter, sondern auch derer Paläste aus Wasserdampf.
Weiter geht's über Horror-Brücken, die mir viel zu eng und zu hoch und voller Trittfallen sind. Manchmal sind es nur ein paar wackelige Holzbretter, die über tosendes Gewässer führen. Ich krieche mehr hinüber, was Binod zum Lachen bringt. In Deurali gönnen wir uns die heutige Dal Bhat Energie-Zufuhr. Nun sind wir bereits auf 3.200 Meter und ich bin heilfroh noch keinerlei Anzeichen von Höhenkrankheit zu spüren. Aber es warten ja noch weitere 900 Meter auf uns.
Wir folgen weiter dem Verlauf des Modi Kholas und überschreiten schließlich die Baumgrenze. Adieu Urwald. Willkommen im Königreich der Wolken. Es beginnt zu regnen – und zwar von allen Seiten. Zwischen den Nebelschwaden zeigen sich immer wieder riesige Felsbrocken. Alles kommt mir archaisch vor, als hätten wir eine urzeitliche Welt betreten, in der einzig Naturgewalten regieren.
Zum wiederholten Mal passieren wir einen einsamen Wanderer aus Bangladesch, dessen Schritte noch abgekämpfter wirken als unsere. Er versucht mir im Vorbeigehen zuzulächeln, schafft es nicht mehr vor lauter Anstrengung und seufzt dann nur leise: „Ich bin so müde ...“
Teufel ja, auch ich spüre allmählig eine bleierne Schwere in meinen Beinen und Schultern. Zugleich erinnert mich dieser Nieselregen an Schottland und heitert mich ungemein auf. Noch geht alles gut voran. Keine Zerrungen, kein Kopfschmerz. Ich fühle mich meinem tapferen Körper näher, denn je. Gerate wieder in eine Art Flow-Zustand, in dem ich plötzlich alles wie aus Distanz wahrnehme: Die schmerzenden Glieder. Der rauschende Fluss. Die endlose Regensuppe. Weiter. Stetig bergauf.
Als wir Machapucharé Base Camp (MBC) erreichen, sind wir schon auf 3.700 Meter. Binod schaut mich fragend an: „Noch zwei Stunden bis zum ABC (Annapurna Base Camp). Sollen wir durchziehen?“ Ich nicke und bin auf einmal fest entschlossen. Werfe mir die Daunenjacke über, weil es nun immer kälter und windiger wird. Jetzt habe ich wirklich alles zum Einsatz gebracht, was ich im Rucksack mit mir trage.
MBC zeigt sich im Vorbeilaufen nur als Nebelsilhouette. Noch 400 Höhenmeter. Es kommt mir vor, als würden wir nun völliges Niemandsland durchqueren. So stelle ich mir Mordor vor. Unsere Sicht reicht kaum 40 Meter weit. Und doch ragen immer wieder Gesteinsbrocken von der Größe von LKWs daraus hervor, als hätten sich auf diesem Feld Titanen eine Steinschlacht geliefert.
Unsere Schritte werden immer schwerer. Wie zwei Traumwandler schlurfen dir durch dieses absolute Nichts, bis selbst der wackere Binod den Satz fallen lässt, den ich vorhin bereits vernommen habe:
„Verdammt bin ich müde ...“
„Nur noch eine Stunde, mein Lieber ...“ Aber wie sich diese Stunde zieht. Man möchte einfach umfallen. Aber noch immer brennt da ein Willensfeuer. Mir wird bewusst: Dieser Weg hier in die Höhe des Himalayas ist zugleich auch der Weg nach Hause. Und Kaffee. Himmel, wie sehr ich mich nun nach einer Tasse Kaffee sehne ...
... und irgendwann erreichen wir ABC. Eine Wandergruppe aus Thailand empfängt uns jubelnd an einem Willkommens-Schild. Alle recken ihre Wanderstöcke voll Enthusiasmus in die Luft. Geschafft. Wirklich geschafft. Mit Ausnahme von Flugzeugen bin ich noch nie in meinem Leben in solchen Höhen gewesen. Über 4.100 Meter.
Wir sind fix und fertig und eilen mit der letzten Kraft weiter zur Unterkunft. Callie, die 19-jährige Amerikanerin, ist bereits da und fällt uns in die Arme. „Wir haben es geschafft, Freunde!“ Am liebsten will ich mich sofort hinlegen, aber Binod rät mir davon ab. „Warte noch bis dein Körper vollends zur Ruhe kommt.“
Mein Kaffeewunsch geht endlich in Erfüllung. Es gibt hier oben sogar eine Dusche. Brühwarm. Himmlisches Gefühl, wie es die Schultern entspannt ...
ABC ist ein eigentümlicher Ort. So stelle ich mir das Leben auf einer Antarktisstation vor. Alle mümmeln sich ein in Daunenjacken, Mützen und Decken. Ich selbst nutze den Abend zum Schreiben. Da erspähe ich etwas außerhalb der Fenster im Dunkeln. – Ist das ein Berg?
Ich lasse alles stehen und liegen. Sprinte hinaus in die Nacht. Himmel, der Wolkenteppich hat sich aufgelöst! Wir sind umringt von Bergen! Die meisten davon über 7.000 Meter hoch. Annapurna I sogar ein Achttausender.
Ich lache aus lauter kindischer Freude. Renne zu Callie und rufe ihr entgegen: „Raus! Raus! Du musst sofort rauskommen!!!“ Ganz ABC ist plötzlich auf den Füßen, um dieses Wunder zu bestaunen, in dem wir gelandet sind. Annapurna Sanctuary. Eine Krone, geformt aus den höchsten Bergen der Welt. Für das Volk der Gurung ein heiliger Ort. Ich kann verstehen weshalb. Sogar der Vollmond zieht auf - direkt hinter Mount Fishtail. Ich weine beinahe vor Glück. Was für ein Naturspektakel ...
Vor Aufregung kann ich nicht einschlafen, gehe nochmals vor die Tür und merke, dass sich noch immer die Berge zeigen. Ganz silbern und erhaben glänzen sie im Mondschein. Das ganze Camp schläft bereits und ist stockfinster. Der Anblick dieser menschenleeren Gebirgswelt gehört mir ganz allein ...
Gegen fünf Uhr klingelt mein Wecker, weil sich dann bereits die ersten Sonnenstrahlen zeigen. Zuerst färbt sich die Spitze von Annapurna I golden. Es ist der zehnthöchste Berg der Erde und benannt nach der gleichnamigen hinduistischen Göttin Annapurna, die Ernährerin. Vermutlich, weil die zahlreichen Flüsse und Bäche dieses Eisklotzes das Umland speisen. Außerdem habe ich gelesen, dass der Berg viele Jahrzehnte lang die höchste Todesopfer-zu-Gipfelerfolg-Rate besessen haben soll, aufgrund der hohen Lawinengefahr.
Schließlich wandert das Licht rüber zu Annapurna South und das gesamte Camp ist wieder auf den Füßen. Alle eilen, um sich vor diesen glühenden Eisgiganten abzulichten. Gebetsfahnen flattern. Die ausgelassene Stimmung ist ansteckend. Ich erkenne zum ersten Mal die gewaltige Gletscherspalte, die sich wie ein Mondkrater zu unserer Rechten auftut. „Im Winter ist sie gefüllt mit Eis“, erklärt mir Binod.
Auch wir geben uns der Fotofreude hin und knipsen etliche Selfies. Danach gönne ich mir das vermutlich epischste Frühstück, das ich je hatte. Auf 4.100 Meter vor einem kaum in Worte zu fassenden Panorama. Und auch wenn ich bereits alles hier in minütlich sich ändernder Lichtstimmung abgelichtet habe, kann sich mein Verstand nicht daran sattsehen.
Ich beobachte die Sonnenstrahlen, die am Machapucharé vorbeiströmen, bis es die Bergspitzen in eine überirdische Gloriole hüllt. Jetzt hat die Sonne auch das Camp erreicht. Hier im Annapurna Sanctuary scheint sie im Regelfall nicht mehr als sieben Stunden pro Tag, wegen der Giganten ringsum.
Tatsächlich höre ich es in der Ferne krachen – offenbar eine Lawine oben an einem der Gipfel. „Darum sperren sie die Camps auch im Januar und Februar“, sagt mir Binod später, „Dann wird es hier viel zu gefährlich, weil immer wieder Eismassen abgehen.“
Ich rufe Callie zum Abschied – sie ist immer noch am Fotos machen und Staunen. Erste Wolken ziehen schon wieder auf. Zeit für den langen Abstieg. Am Ausgang des Camps sehen wir eine Gruppe, die einen Mann mittleren Alters stützt. Er schafft es nur wenige Meter und muss sich sofort wieder hinsetzen. Ob ihn die Höhenkrankheit erwischt hat? „Ich hoffe, sie rufen einen Heli. Bis zum MBC wird er den gesamten Tag brauchen in seinem Zustand.“
Wir machen uns auf. Wie vollkommen anders sich heute der Weg präsentiert, den wir gestern durch dicksten Nebel hinaufgekrochen sind: Alles leuchtet in satten Farben. Wunderschöne Blüten säumen den Weg. Berge, soweit das Auge reicht.
Auch wenn wir dutzende Male halten, um Fotos zu schießen, erreichen wir MBC bereits nach einer Stunde. Doppelt so schnell wie gestern.
Kurz darauf hören wir Propellergeräusche. Die Luftretter sausen über uns hinweg. Gutes Zeichen - der Mann wird vermutlich direkt nach Pokhara ins Krankenhaus geflogen.
Wir betreten das von nackten Felswänden flankierte Tal. Ich muss mich sehr ans Abwärtslaufen gewöhnen. An den etwas flacheren Passagen lässt sich mit herrlich leichtem Schritt Geschwindigkeit aufnehmen. Wird es aber steiler und gerölliger, schalte ich in den Opi-Modus und taste mich mit den Wanderstöcken vor von Stein zu Stein. Das kostet meinen Körper zwar weniger Energie als hinauf, aber ich merke, wie es durch die stetige Konzentration anstrengt. Einen Fehltritt will ich nicht riskieren, auch wenn ich etwas neidisch auf die Nepalesen blicke, die wie Bergziegen flink hinunter ins Tal hopsen und dabei selbst an den steilsten Stellen kaum an Tempo verlieren. Egal. Mein Tempo, meine Trittsicherheit.
In Dovan, unserer Unterkunft vor dem ABC, meint Binod mit Blick auf den Wolkenhimmel: „Lass uns hierbleiben. Im Regen durch den Urwald ist kein Spaß. Hier ist es außerdem viel ruhiger als in dem touristischen Bamboo zwei Stunden weiter. Wir schonen unsere Knie. Und morgen schaffen wir es dann immer noch entspannt bis Chhomrong.“
Später schaue ich müde einem Jungen dabei zu, wie er Bambus zum Kochen zerkleinert. Beim Abendessen gesteht mir Binod: „Als ich heute gesehen habe, wie massiv der Gletscher zurückgegangen ist, dachte ich mir: Das Annapurna Sanctuary wird es in zehn Jahren so nicht mehr geben.“ Ich bekomme als kleinen Nachschlag noch etwas von dem Bambus angeboten, was ausgezeichnet schmeckt. „Der Junge, der das zubereitet hat, muss als ältester Sohn seiner Familie eine Menge Verantwortung tragen und verdient sich hier in der Unterkunft etwas dazu.“
Ich erkenne immer deutlicher: Alle hier in dieser Berghütte müssen irgendwie durchkommen. Überleben. Sie bereiten Essen, Getränke und Schlafplätze für die Wanderer zu. Binod erzählt mir von seiner Arbeit und langjährigen Kunden, die hoffentlich ab Oktober wieder seine Dienste als Guide in Anspruch nehmen. Sein Job konzentriere sich gänzlich auf die Hauptsaison, die dann beginnt. In dieser Zeit muss er durch Trekking genug für seine fünfköpfige Familie verdienen.
Ja, alle hier in dieser Berghütte versuchen durchzukommen. Nur ich gehöre zu den Exoten, die sich in ihrer Freizeit ein spaßiges Abenteuer leisten, von dem diese Menschen wiederum überleben müssen …
„Was denken die Leute in deinem Land über uns?“ Diese Frage ist mir nun schon mehrmals begegnet, wenn man sich lange und intensiv mit den Menschen hier unterhält. Ich habe den Eindruck, daraus spricht die Hoffnung, dass Nepal nicht nur auf ein Land mit materieller Armut und Entwicklungsproblemen reduziert wird. Nicht nur ein kleiner Himalaya-Staat, eingequetscht zwischen China und Indien. Nicht nur eine Erdbebenmeldung in den Nachrichten.
Aus der Frage spricht der Wunsch, dass die Menschen hier wahrgenommen, dass die Vielfalt dieses Landes gesehen wird. Immerhin umfasst Nepal etliche klimatische Zonen: Vom subtropischen Terai (am tiefsten Punkt 60 Meter) bis zum alpinen Bergland und dem höchsten Punkt der Erde auf dem 8.848 Meter hohen Sagarmatha, wie die Sherpa den Mount Everest nennen.
Laut dem nepalesischen Professor Dr. Balmukunda Regmi tummeln sich hier auf knapp 0.1 % der Welt-Landfläche immerhin 3,26 % der Flora und 1,1 % der Fauna der gesamten Erde. Die 130 Sprachen hier umfassen etwa 1,8 % aller gesprochene Sprachen auf dem Globus. Die Menschen sind stolz auf ihre kulturellen Traditionen, die sie bewahren konnten, weil sie nie kolonialisiert wurden. Diese Vielfalt wird gelebt, indem nahezu alles von den Bergen, Flüssen, Tieren, Pflanzen und Menschen als heilig und schützenswert betrachtet wird. Als Teil von einem größeren Ganzen. So auch der Fremde, der – ganz gleich, wo er oder sie hingeht – ein respektvolles „Namasté“ ernten wird. Einen Gruß an das Göttliche in uns allen.
Theater in Kathmandu
Nepal 2023
Es ist das erste Mal in Nepal, dass ich mich nicht wie ein Tourist fühle, sondern als Künstler und Autor, der von einer jungen Theatergruppe eingeladen wurde. Ich breche früh auf. Fahre mit dem Taxi zum Shilpee Theater und habe sofort wieder das Gefühl hier in einer offenen kulturellen Begegnungsstätte gelandet zu sein.
Während ich meine Notizen für den heutigen Workshop durchblättere, wird im Hof gefegt. Es geht zu wie in einer Kommune, in der jede Person alle Aufgaben mitübernimmt nach einem eingespielten Ablauf: Morgens gemeinsam putzen. Von 9 bis 15 Uhr Theaterunterricht, unterbrochen vom gemeinsamen Kochen und Essen. Dann Vorbereitungen für die tägliche Abendvorstellung. Einlass. Showtime. Austausch mit dem Publikum. Schlafengehen. Viele der jungen Darsteller:innen leben hier in Unterkünften, weil ihre Familien in ganz Nepal verstreut sind.
Wir starten mit einer Gesprächsrunde zum Thema Live-Hörspiel. Yubaraj, der Theaterleiter und Regisseur, übersetzt alle meine Passagen ins Nepalesische für diejenigen, die nicht ganz so fit sind im Englischen. Ich merke direkt, wie herrlich divers und zugleich aufgeschlossen dieses Ensemble ist. Durch ihre verschiedenen Herkunftsorte tragen sie ganz unterschiedliches kulturelles Gepäck aus Traditionen, Riten und Sprache mit sich. Als würde sich die Vielfalt Nepals in diesen jungen Gesichtern widerspiegeln. Was uns alle jedoch verbindet, ist die Freude am Darstellenden Spiel.
Die meisten verknüpfen Hörspiele mit ihrer Kindheit und erzählen, wie sie als Kinder die traditionellen Gebetsinstrumente mit Alltagsgegenständen nachgeahmt haben. Yubaraj berichtet von Donnermaschinen in den alten königlichen Theaterbühnen.
Zur Mittagspause gibt es natürlich Dal Bhat, was von der Gruppe frisch zubereitet wird. Wie ein Ensemblemitglied sitze ich mitten in der Runde. Beantwortet zahlreiche Fragen: „Wie hört sich für dich Nepalesisch vom Klang her an?“ „Wie würdest du eine Regenmaschine mikrofonieren?“ „Wie arbeite ich als Sprecher mit regionalen Akzenten?“
Später sammeln wir Props – also Gegenstände, um Geräusche zu erzeugen. Die Präsentationsrunde hat schon fast etwas Meditatives. Alle schließen die Augen und werfen Assoziationen in den Raum, für was das jeweilige Geräusch stehen könnte. So lauschen und konzentrieren wir uns völlig auf das jeweilige Knistern, Kratzen, Scharren, Säuseln, Klopfen, Knacken, Wispern ...
Am Ende der beiden Workshoptage werde ich wie ein alter Weggefährte verabschiedet. Welche Freude das eigene Erfahrungswissen zu teilen. Einer Laune folgend krame ich in meinem Geldgürtel nach meinen letzten Dollar-Scheinen. Mein Notgroschen, sollte je der Worst Case auf dieser Reise eintreffen. Doch Nepal hat mich heil durchgebracht. Ich brauche das Geld nicht mehr und spende es für die Theaterarbeit dieser jungen Leute. Für nepalesische Verhältnisse ist es ein riesiger Betrag. Daher macht es mich fast verlegen, als alle plötzlich in Jubel ausbrechen. Eigentlich möchte ich ihnen damit nur das Beste wünschen und diesen besonderen Ort für Theaterkunst in Nepal noch etwas mehr unterstützen.
Abends setzt sich Yubaraj zu mir an den Tisch. Lädt mich auf ein Bierchen ein. Dann noch eins. Wir quatschen. Stundenlang übers Theatermachen. Teilen ein gemeinsames Feuer. Eine Leidenschaft, die uns zum Schreiben treibt. Zum geschriebenen Ausdruck, „bis du nicht mehr anders kannst als diese Geschichten, diese Figuren auf die Welt loszulassen.“
Es ist eine herrliche Unterhaltung, wie ich sie lange nicht geführt habe. Gänzlich auf Augenhöhe und sich gegenseitig in den Ideen befruchtend. Yubaraj schenkt mir ein Exemplar seines letzten Stückes: „The Salvation“. Es ist in Devanagari Zeichen geschrieben, aber danke Google kann ich grob den Inhalt entziffern. Er liefert mir eine Zusammenfassung: Es geht um ein altes Paar und ihre jüngere Version voneinander – also vier Darsteller:innen. Eine romantische Liebe, die aufgrund verschiedener Kasten nicht sein darf und beide Figuren im Alter mit inneren Narben zurücklässt.
Weil ich das Shilpee als Safe Space erlebt habe, in dem alle unabhängig ihres Geschlechts und ihrer Kastenherkunft gleichbehandelt werden, hake ich an diesem Punkt nach. „Leider sind Orte wie das Shilpee in Nepal immer noch eine Besonderheit“, bestätigt Yubaraj, „Und wenn wir mit dem Bus in den Provinzen unterwegs sind, werden die Ensemblemitglieder oft unterschiedlich behandelt. Abhängig von ihrer Hautfarbe. Aber innerhalb unserer Theaterfamilie sind alle gleich. Das ist das wichtigste Fundament. Dafür kämpfen wir mit unserer Kunst.“
Beim dritten Bier fängt es schließlich wie aus Kübeln an zu regnen. Yubaraj fragt nach meinen Stücken und ich übersetze ihm die Prolog-Szene aus ‚Orson Welles und der Krieg der Welten‘. Dabei merke ich, wie er Feuer fängt und biete ihm an das Live-Hörspiel ins Englische zu übersetzen. „Wozu den umständlichen Zwischenschritt? Ich habe Freunde, die können das vom Deutschen direkt ins Nepalesische übertragen.“ Ich lache begeistert: „Wenn du ‚Orson Welles‘ hier in Kathmandu spielen möchtest, hast du mein Segen. Das wäre mir eine große Ehre.“ Eine schelmische Begeisterung blitzt aus seinen Augen, der ich mich nicht entziehen kann: „Weißt du, Philipp, es ist möglich. Warum es also nicht einfach wagen?“
Ankommen lernen
Deutschland 2023
Es wird dauern. Zwar ist mein Körper bereits zurück in Deutschland. Kopf und Herz verweilen allerdings noch in 6.600 km Entfernung. Wenn ich Mainz so ansehe, ist es, als hätte dieser Reisemonat nie existiert. Doch er muss es. Zu viel hat sich schließlich verändert – in mir.
Schon bei Kleinigkeiten merke ich, wie ich mich in Erinnerungen, in Gewohnheiten verheddere: Ich kann wieder Wasser aus dem Hahn trinken, Klopapier in der Toilette runterspülen. Kaufe mir Reis und Linsen und merke, wie teuer alles wieder ist. Keine neugierige Blicke mehr auf den Straßen. Keine Höflichkeitsrituale. Kein „Namasté“. Geordneter, ruhiger Straßenverkehr. Saubere Luft. Und Reichtum … Reichtum ohne Ende, der von den Menschen kaum noch wahrgenommen wird.
Ich denke an Binod, meinen Guide, und hoffe, dass ihm die Saison genügend Kundschaft beschert, damit er seine Familie durchbringt. Ich denke an Ruth, die einsame, alte Hippie-Dame. An Yubaraj und sein Ensemble, die bald zu einer Bustour in die Provinzen aufbrechen. An Callie, die durch den Urwald davon ist, um es rechtzeitig nach Pokhara, rechtzeitig nach Kathmandu und dann wieder rechtzeitig nach Sri Lanka zu schaffen. Das Herz zieht weite Kreise und ist trotz allem nicht zerstreut.
Zugleich spüre ich, dass ich diese Veränderungen in mir auf meinen Alltag übertragen möchte. Wie genau weiß ich noch nicht. Es ist bislang mehr Intention als Plan. Ich will nicht stagnieren. Will weitergehen, wenn auch erstmal wieder in gewohnten Bahnen. Ich möchte mich weiter im ‚Geben’ üben und all diese Erfahrungen verwandeln – vielleicht in etwas Künstlerisches? In Kathmandu habe ich einen jungen Designer kennengelernt, Siddhanta, der meinte, die größte Kunst wecke das Menschliche in uns. Zeige uns eine Wahrheit über das Mensch-Sein.
Ich möchte den Mut bewahren, meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn es manchmal steinig werden kann und es keine Brücken über reißende Ströme gibt. Ich möchte mutig sein Emotionen zuzulassen. Mehr unternehmen, gegen die gewaltige Ungleichheit, die diese Welt zerteilt. Meine Nepal-Reise ist für mich längst nicht abgeschlossen. Vielleicht fängt es gerade sogar erst an.
Ich spiele mit der Kette an meinem rechten Handgelenk. Eines der wenigen Souvenirs, die mich an das Geschehene erinnern soll. An das Leben in der Gegenwart. Daran, dass Kreise-Ziehen und scheinbare Ziellosigkeit dich dir selbst auch näherbringen können. Auch wenn du als Fremder durch diese Welt wandelst, kannst du überall Gärten der Freundschaft säen.
All diese Reisen machen zu dürfen, empfinde ich nun mehr denn je als ein Privileg und freue mich, wenn ich durch die Kraft der Worte etwas von meinen Erlebnissen weitergeben kann. Und wenn du mich nun fragst: „Hat es dich verändert?“, so werde ich das bejahen. Weil es mir neue Perspektiven geschenkt hat. Weil es mehr war als Sightseeing und die ‚Koordination von Schlafen, Essen und Transport‘. Und wenn du mich dann fragst: „Was war das Schönste?”, so werde ich dir Namen nennen: Václav, Manfred, Waltraud, Axel, Reem, Victor, Badal, Krish, Binod, Callie, Ruth, Siddhanta, Yubaraj, seine Theatergruppe, und so viele mehr, die ich nicht namentlich erwähnt habe. Sie alle und weitere haben auf die ein oder andere Weise Abdrücke hinterlassen und waren Teil meines kurvenreichen Weges.
Download
Unterwegs als E-Book (epub und mobi)
Unterwegs als PDF
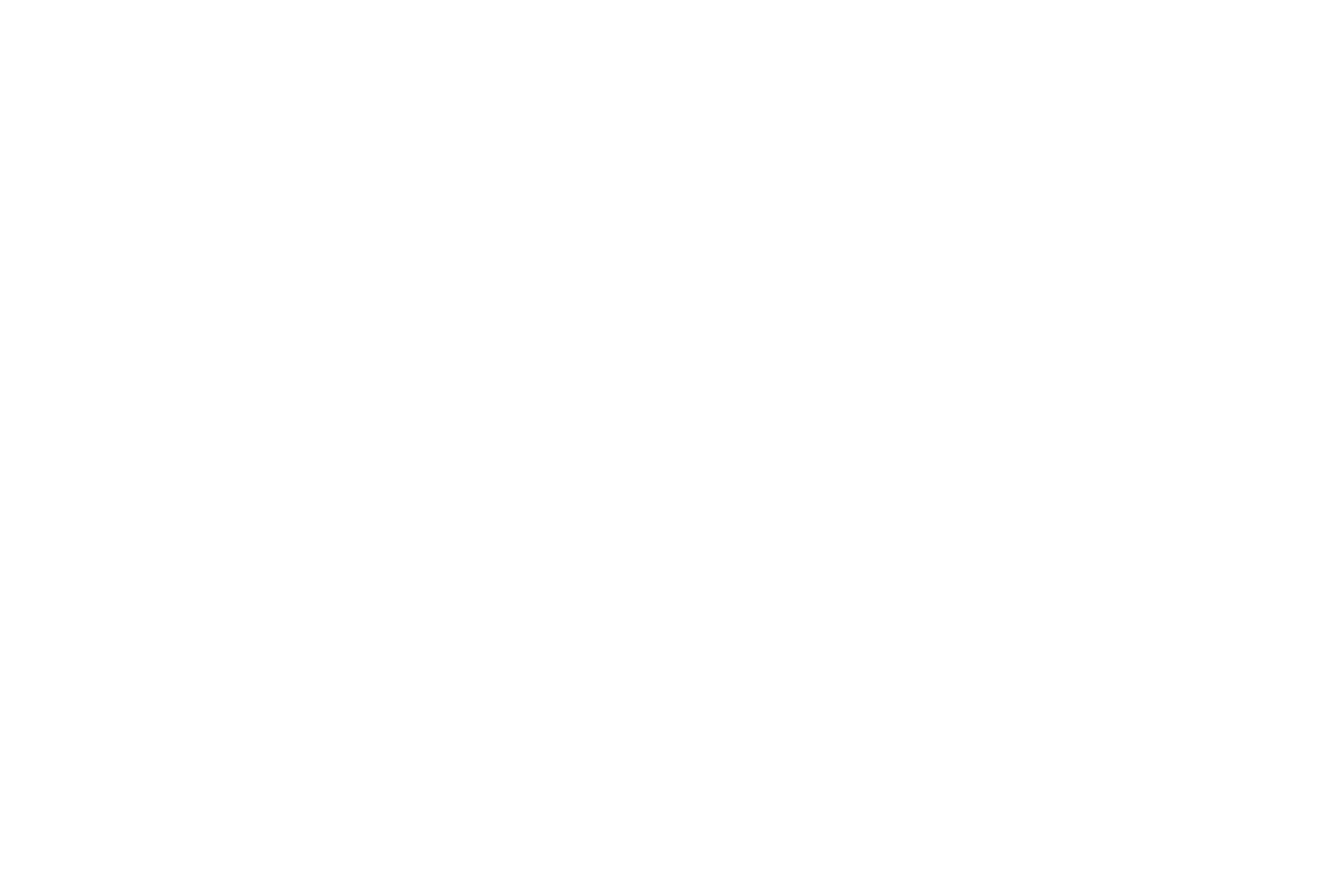
Annapurna Base Camp, Nepal | Aug 2023
